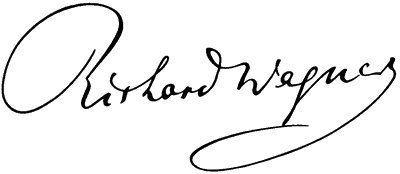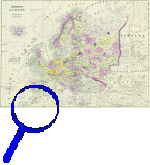|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
1813 |
Am 22. Mai wird (Wilhelm) Richard Wagner in
Leipzig geboren, einer Stadt mit
etwa 36,000 Einwohnern im Königreich Sachsen. Er ist das letzte von neun
Kindern der Johanna Rosine, geborener Pätz, und ihres Ehemanns Friedrich
Wagner. Die Familie lebt in bescheidenen Umständen; der Vater ist Aktuar bei
der Stadtpolizei und hat damit nach der damaligen Definition eine mittlere
Beamtenstelle. Die Eltern sind beide Amateur-Schauspieler. *Die farbig markierten Städte finden sich auf der zeitgenössischen Karte (rechts) so wie sie hier geschrieben sind. Leipzig ist eine aufstrebende Handelsstadt mit einer gut besuchten Universität und besitzt den Ruf eines der wichtigesten kulturellen Zentren in Deutschland: es gibt hier 56 Buchläden und drei Musikalienhandlungen, darunter der Verlag Breitkopf & Härtel. Im November stirbt der Vater in einer Typhus-Epidemie, in der Zeit der Not nach dem Befreiungskrieg, der eben, am 19. Oktober, mit der Völkerschlacht bei Leipzig und der Niederlage Napoleons ein Ende gefunden hat. Im gleichen Jahr wird Giuseppe Verdi in der italienischen Stadt Roncole bei Parina geboren. Ludwig van Beethoven ist 43 Jahre alt, Franz Liszt erst 2. |
|
1814 |
Im August heiratet RWs Mutter den gut aussehenden Schauspieler, Autor und Porträtisten Ludwig Geyer. Die Familie zieht nach Dresden, wo der neue Vater eine Stelle als Schauspieler am Hoftheater gefunden hat. | |
1817 |
Stiefvater Geyer wird als Verfasser von dramatischen
Schauspielen sehr geschätzt und damit bessert sich die finanzielle Lage der
Familie. Der Komponist Carl Maria von Weber, der neue Direktor des
Opernhauses, wird ein naher Freund.
Zu dieser Zeit gibt es noch keine Schulpflicht, aber RW erhält Unterricht in Lesen und Schreiben, erst von einem Hofbeamten und später in einem Internat ausserhalb Dresdens, das unter der Leitung eines Geistlichen steht. |
|
1821 |
Im September stirbt der Stiefvater im Alter von nur 43 Jahren nach einer lange anhaltenden »nervösen Schwäche«, wie es in der offiziellen Todesurkunde heisst. Andeutungen in der Literatur, wonach Ludwig Geyer der leibliche Vater Richard Wagners gewesen sei, sind nicht begründet. | |
1822 |
RW geht unter dem Namen Richard Geyer auf die Kreuzschule in Dresden aber wird nur in eine Klasse niedriger als seinem Alter enspricht zugelassen. Er ist fasziniert von Mythologie, liebt romantische Geschichten und ist zu allem Fantastischen gezogen. Er schreibt Gedichte und spielt gerne Lieder auf dem Klavier, aber er ist kein Wunderkind. | |
1823 |
Richard ist oft in Dresdens Königlichem Opernhaus zu finden, damals das grösste und grossartigste in Deutschland. Seine Schwestern Rosalie und Klara, beide angehende Sängerinnen, verhelfen ihm zu freiem Zugang bei Proben und Vorstellungen. Carl Maria von Webers romantische Oper Der Freischütz beeindruckt den kleinen Jungen, besonders auch der Komponist und Dirigent durch seine autoritative Behandlung der Musik, der Musiker und der Darsteller. | |
1826 |
RWs Schwester Rosalie wird als Sängerin an einem Theater in
Prag engagiert; die Familie folgt
ihrem guten Einkommen. Richard bleibt in
Dresden bei einem Dr. Böhme und
geht dort weiter zur Schule. Zu seinen ersten literarischen Versuchen zählt
ein Drama in Hexametern nach Homers Odyssee (verschollen).
Der sehr beliebte und verehrte Komponist Carl Maria von Weber stirbt im Alter von nur 40 Jahren. |
|
1827 |
Richard verbringt ein Woche mit Mutter und Schwester in Prag. Im Dezember zieht er mit der Familie nach Leipzig, auch mit diesem Umzug Rosalie folgend, die gerade eine der Hauptdarstellerinnen am dortigen Theater geworden ist. Von jetzt an führt er den Namen Richard Wagner. | |
1828 |
Das Nicolai-Gymnasium nimmt RW nur in die fünfte Klasse auf; er ist mindestens ein Jahr älter als die meisten seiner Klassenkameraden. Er besucht mehrmals seinen reichen und gebildeten Onkel Adolf Wagner und sagt später, dass er von ihm mehr gelernt habe als auf den verschiedenen Schulen. Er spielt nicht besonders gut Klavier aber interessiert sich zusehends mehr für Musik und versucht, die Kunst der Komposition aus Büchern zu lernen. | |
1829 |
Richard Wagner hört die berühmte Coloratur-Sopranistin
Wilhelmine Schröder-Devrient in Beethovens Fidelio und ist so
beeindruckt von ihrem Vortrag, dass er beschliesst Komponist zu werden.
Seine ersten Werke sind, u.a., eine Sonate für Klavier in d-moll (WWV
2*), ein Quartett für Streichinstrumente in D-dur (WWV 4) und eine
Sonate für Klavier in f-moll (WWV 5); alle diese Arbeiten sind verloren
gegangen. *WWV = Wagner-Werkverzeichnis. |
|
1830 |
Kurz bevor er wegen schlechter Noten von der Schule
verwiesen wird, verlässt Richard Wagner das Gymnasium. Er bringt es fertig,
in die berühmte Thomas-Schule aufgenommen zu werden, aber er ändert nichts
an seinen schlechten Gewohnheiten, schwänzt die Schule und verbringt seine
Zeit mit Komponieren; unter vielen anderen Werken schreibt er die
Paukenschlag-Ouvertüre in B-dur, WWV 10, die im Dezember öffentlich
aufgeführt wird. Das Publikum reagiert mit Gelächter.
Er ist jetzt 17 Jahre alt und verdient sich ein bisschen Geld als Korrektor einer neuen Auflage der Geschichte der Welt, herausgegeben von Friedrich Brockhaus, dem Verlobten seiner Schwester Luise. Mit dieser Arbeit erwirbt er eine umfassende Kenntnis insbesondere der Geschichte des Mittelalters, und einige der Personen und Ereignisse, von denen er liest, verwendet er später in seinen Werken (z.B. in der Oper Rienzi). |
|
1831 |
Im Februar verlässt RW die Schule ohne Abitur, damit ohne die offizielle Berechtigung an der Universität zu studieren, aber ihm gelingt es dennoch, zum Musikstudium an der Universität Leipzig zugelassen zu werden. Theodor Weinlig, Kantor der Thomas-Schule, gibt Richard bis etwa September Kompositions-Unterricht und ist zufrieden mit den Fortschritten seines Schülers. RW ist sehr fleising; seine Konzert-Ouvertüre in d-moll (WWV 20) wird vom Publikum bei ihrer Premiere gut aufgenommen. | |
1832 |
RW schreibt seine Symphonie in C-dur (WWV 29), die schon im Herbst vom Orchester des Conservatoriums in Prag öffentlich gespielt wird. Seine Konzert-Ouvertüre in d-moll erhält bei einer Aufführung des Gewandhaus-Orchesters in Leipzig reichen Applaus. | |
1833 |
Wagner schreibt das Libretto und einen Grossteil der Partitur seiner ersten Oper, Die Feen (WWV 32), eines romantischen Märchens. Er ist sehr aktiv in einer Studentenverbindung und ständig in Geldnot, aus der ihn seine Schwester Rosalie, jetzt eine bekannte Schauspielerin, mehrere Male erlöst. | |
1834 |
RW wird der schlecht bezahlte Musikdirektor einer schlecht geführten reisenden Theatertruppe mit Verwaltungssitz in Lauchstädt bei Magdeburg. Er verliebt sich in die Schauspielerin Wilhelmine (Minna) Planer, die vier Jahre älter ist als er und eine kleine Tochter hat. Seine erste Vorstellung ist als Dirigent von Mozarts Don Giovanni. | |
1836 |
Die Erstaufführung Richard Wagners neuer Oper Das Liebesverbot (WWV 38) ist eine Katastophe. Die Theatertruppe macht bankrott. Er entflieht mit Minna seinen Gläubigern nach Königsberg, wo er hofft eine Anstellung als Musikdirektor zu bekommen. Im November heiraten Richard und Minna, obwohl RW keine Stelle und daher keinerlei Einkommen hat. | |
1837 |
Wagner wird die Stelle eines Musikdirektors in Riga
angeboten. Hier (zu dieser Zeit gehört Riga zu Russland) fühlt er sich
sicher vor seinen Gläubigern. Seine Frau verlässt ihn mit einem
Handlungsreisenden, kommt aber gegen Ende des Jahres zu ihm zurück. Im
Oktober stirbt RWs geliebte Schwester Rosalie.
Anfangs hat Wagner Erfolg in seiner neuen Stellung, aber dann beschweren sich die Musiker über die langen Proben und auch darüber, dass er ständig etwas auszusetzen habe. Er selbst ist nicht zufrieden, da Riga ihm keine Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Er lebt, wie gewöhnlich, weit über seine Verhältnisse, hat Eheschwierigkeiten und will weg nach Paris, damals die Musik-Hauptstadt der Welt, die er mit seiner neuen grandiosen Oper Rienzi zu erobern hofft. |
|
1839 |
Anfangs Juli flieht er mit Minna und ihrer Tochter (die sie
immer als ihre kleine Schwester ausgibt) in abenteuerlicher Weise über die
russisch-preussische Grenze, dann mit einem verkommenen kleinen Segelschiff
nach Norwegen und schliesslich nach London. Niemand der Familie ist im
Besitz eines gültigen Passes und sie haben kaum noch Geld. Auf dieser sehr
erlebnisreichen Fahrt, die fast einen ganzen Monat dauert, kommt es fast zum
Schiffbruch an der felsigen Küste Norwegens und Wagner hört zum ersten Mal
die Geschichte vom fliegenden Holländer.
Nach kurzem Aufenthalt in London zieht die Familie weiter und nimmt eine Wohnung in einem Vorort von Paris. |
|
1840 |
Wagner verspricht sich viel von der Bekanntschaft mit Giacomo Meyerbeer und hofft, dass dieser berühmte Komponist ihm mit Empfehlungen weiterhelfe. Alle diese Erwartungen kommen zu nichts und RW muss sich deshalb, wie gewohnt, überall Geld leihen, zum Beispiel auch von einem guten Freund mit der Schwindelei, dass er schon im Schuldgefängnis sitze. Trotzdem wird seine grosse Oper Rienzi (WWV 49) im November fertig. | |
1841 |
Auf die Empfehlungen von Wilhelmine Schröder-Devrient und
Giacomo Meyerbeer zeigt sich das königlich-sächsische Hoftheater in
Dresden
gewillt, Rienzi aufzuführen, aber nur unter der Bedingung, dass
Wagner einige Hinweise überarbeite, die gegen die Autorität von Kirche und
Staat gerichtet zu sein scheinen.
Die Grand Opéra de Paris gibt Wagner einen Vorschuss von 500 Francs (der Betrag entspricht etwa 2.200 Euro in heutiger Kaufkraft) auf einen ersten Entwurf seiner neuen Oper Der fliegende Holländer. Die Ouvertüre wird im November als letzter Teil vollendet. |
|
1842 |
Da es in Paris keine Aussichten auf weitere Arbeit gibt, zieht die Familie im April zurück nach Dresden. Dort ist die Premiere der Oper Rienzi trotz einer Dauer von sechs Stunden ein grosser Erfolg. Wagner erhält ein nur bescheidenes Honorar, das aber die Familie dringend braucht und die ärgerlichsten Gläubiger befriedigt. | |
1843 |
Die erste öffentliche Aufführung des Fliegenden
Holländers (WWV 63) im Januar in Dresden ist nicht ganz der erhoffte
Erfolg. Es sollte eine romantische Oper sein; Wagner schreibt später, dass
er in ihr zum ersten Mal seine Vorstellungen über das Musikdrama ausgedrückt
habe, nach denen Poesie und Musik unzertrennlich zu einer Einheit verbunden
sind. Die Idee des Gesamtkunstwerks wird etwa 1850 von ihm formuliert
aber findet hier ihren Anfang.
Einen Monat später wird er zum Kapellmeister am königlich-sächsischen Hof in Dresden ernannt; er bezieht in dieser Stelle ein Gehalt von 1500 Talern pro Jahr. Zum Vergleich: der Dichter Johann Wolfgang Goethe hat ein Jahresgehalt von 3000 Talern als Finanzminister am Hof von Herzog Carl-August im benachbarten Land Sachsen-Weimar. Endlich verfügt Wagner über ein sicheres und geregeltes Einkommen, aber die Gläubiger von nah und fern bestehen jetzt auf Zahlung seiner Schulden. Diesmal kommt er aus des misslichen Lage dadurch, dass er sich die beträchtliche Summe von 1000 Talern von seiner Primadonna, Wilhelmine Schröder-Devrient, leiht, ein Betrag, der fast ein Viertel ihres Jahreseinkommens ausmacht. Wagner gibt das geborgte Geld verschwenderisch aus, z.B. benutzt er im August 5000 geliehene Taler, um seine neue Wohnung standesgerecht zu möblieren. Die Aufführungen von Carl Maria von Webers Opern Euryanthe und Der Freischütz unter Wagners Leitung werden sehr gut vom Publikum aufgenommen. Der Text für die Oper Tannhäuser wird fertig. |
|
1844 |
Wagners Opern Rienzi und Der fliegende Holländer
werden in Berlin, Hamburg und Dresden aufgeführt, zum Teil unter seiner
Leitung. Trotz der vielen dadurch bedingten Reisen macht er gute
Fortschritte mit der Komposition der Oper Tannhäuser. Er betreibt und
organisiert die Überführung des 1826 in London verstorbenen Carl Maria von
Weber nach Dresden.
Grossen Applaus erntet Wagner mit seiner Interpretation von Beethovens Symphonie Pastorale (op. 68). |
|
1845 |
Die romantische Oper Tannhäuser (WWV 70) ist fertig.
In der Zeit von April bis August schreibt Wagner die vollständigen Entwürfe
der Opern Die Meistersinger von Nürnberg und Lohengrin.
Im Oktober ist die Erstaufführung von Tannhäuser in Dresden; Wagner dirigiert selbst. Die Oper kommt nicht gut an. Der Komponist kennt ihre schwachen Stellen, wie er in seiner Autobiographie schreibt, und arbeitet an verbesserten Fassungen bis zum Ende seiner Tage. Das Libretto für die Oper Lohengrin wird im November fertig. |
|
1846 |
Wagners Darbietung der Neunten Symphonie von Ludwig
van Beethoven (op. 125) erhält stürmischen Beifall.
Schröder-Devrient besteht auf Rückzahlung der 1843 von ihr geliehenen Summe von 1000 Talern. Er erwirkt ein Darlehen von 5000 Talern aus der Pensionskasse der Musiker; die monatlichen Abzahlungen verschlingen mehr als ein Viertel seines Salärs, bevor er daran denken kann, anderen Gläubigern etwas zurückzugeben. Er ist jetzt 33 Jahre alt, dabei schon ein geschätzter Dirigent und ein reifer wie schöpferischer Komponist mit einem geregelten Einkommen. Seine ständigen Geldprobleme sind wahrscheinlich verbunden mit dem Wunsch nach einem Grad von Anerkennung, der seiner eigenen Wertschätzung entspricht. |
|
1848 |
Richard Wagner macht den Fehler, im Vaterlandsverein
Dresdens eine Rede mit dem Titel »Wie verhalten sich republikanische
Bestrebungen dem Königtum gegenüber?« zu halten. Er sympathisiert ganz offen
mit den Revolutionären in Wien und schickt ihnen ein Gedicht, das ihre
Initiative preist. Dummerweise wird es in einer österreichischen Zeitung in
dem Moment veröffentlicht, als es auch zu Aufständen in
Dresden kommt. Die
Folge ist, dass seine Tätigkeit am Theater beschnitten wird, aber das lässt
ihm eben mehr Zeit zum Komponieren.
Im Laufe diesen Jahres bewältigt er eine unglaubliche Menge von Arbeit: er komponiert die Musik für die Oper Lohengrin (WWV 75) und schreibt den ersten Entwurf einer Szene (Siegfrieds Tod), die er später im Ring des Nibelungen benutzt; er tritt auf in Konzerten mit Werken von Beethoven, Gluck, Haydn, Mozart und Mendelssohn (der im Jahr zuvor vestorben ist); er schickt einen langen und wohl überlegten Brief and den Abgeordneten Sachsens in der neu konstituierten Nationalversammlung in Frankfurt, in dem er spezifische politische und territoriale Reformen fordert. RW macht die Bekanntschaft von Michael Bakunin, einem russischen Anarchisten, der von der Polizei mehrerer Länder gesucht wird, weil er zum offenen Krieg und individuellen Terror-Handlungen gegen alle Institutionen der Kirche und des Staats aufruft. |
|
1849 |
Franz Liszt, Musikdirektor in Weimar, bringt Wagners
Tannhäuser zur Aufführung.
Die Wagners werden erfasst von den revolutionären Unruhen in Dresden, die zu Gefechten zwischen der Armee und den Aufständischen und schliesslich zur Flucht des Königs führen. Als preussische Truppen Dresden belagern und die Niederlage der Rebellen kurz bevorsteht, entkommen RW und Minna nach Chemnitz, 60 km südwestlich gelegen. Er wird mit einem Haftbefehl gesucht aber noch rechtzeitig gewarnt und bleibt auf der Flucht, mit finanzieller Unterstützung von Franz Liszt. Ein Freund gibt ihm seinen schon abgelaufenen Pass und er entkommt damit im Mai ohne Schwierigkeiten über die Grenze in die Schweiz. Minna ist natürlich unglücklich darüber, dass sie ihr relativ ruhiges Leben aufgeben müssen und kommt mit ihrer Tochter erst im September zu ihm nach Zürich. RW schreibt ein paar Aufsätze, in denen er seine Neigung zum Kommunismus und seine Ansichten über die Zukunft der Kunst darlegt, aber zum Komponieren findet er das ganze Jahr über keine Zeit. |
|
1850 |
Eine Reise nach Paris enttäuscht, weil niemand an seinen
Opern interessiert zu sein scheint.
Eine Frau Ritter aus Dresden hört vom unsicheren Leben Wagners im Züricher Exil und gewährt ihm eine Zuwendung von zuerst 500, später 800 Talern pro Jahr, vorausgesetzt er verschafft ihrem Sohn Karl eine gründliche musikalische Ausbildung. Wagner veröffentlicht unter einem Pseudonym in der Neuen Zeitschrift für Musik den Aufsatz »Das Judentum in der Musik«, in dem er seinen früheren Freund Giacomo Meyerbeer wütend angreift. Er wirft ihm vor, den Wünschen des Publikums nach billiger Unterhaltungsmusik nachzukommen. |
|
1851 |
Ausarbeitung von Prosa-Entwürfen von Der junge Siegfried,
Skizzen für die Opern Das Rheingold und Die Walküre. Wachsende
Entfremdung von Minna und Richard.
RW leidet an einem hässlichen Erysipel im Gesicht (i.e. eine Streptokokken-Infektion der Haut), das ihn seit seiner Kindheit plagt. |
|
1852 |
In den ersten sechs Monaten des Jahres verfasst Wagner das
gesamte Libretto für Die Walküre in Versen, in der zweiten Hälfte den
Operntext für Das Rheingold. Da es ihm nicht erlaubt ist, in die
deutschen Staaten einzureisen, antwortet er auf Gesuche von Theaterhäusern
in Schwerin, Breslau, Prag, Wiesbaden und Berlin, seine Opern Tannhäuser
und Der fliegende Holländer zu produzieren damit, dass er
ausführliche Anleitungen zur Aufführung dieser Werke schreibt. Er hat jetzt
sehr gute Einkünfte als unabhängiger Künstler und freut sich, wenn er
eingeladen wird seine Werke zu dirigieren. Einen Grossteil seiner Zeit
verbringt er mit Arbeit am Ring des Nibelungen, einer mächtigen
Tetralogie von Opern, die in der von ihm gewünschten opulenten Form in
keinem der damals existierenden Opernhäuser hätte auf die Bühne gebracht
werden können: der Aufwand an Personal, Raum, Einrichtung und Gerät ist zu
extravagant. Er beginnt über den Entwurf eines ganz speziell für die Anforderungen seiner grossen Opern zu errichtenden Hauses nachzudenken. |
|
1853 |
Langsam beginnen die Tantiemen für Tannhäuser,
Der fliegende Holländer und Lohengrin zu fliessen. Viele Ausgaben
der Familie Wagner werden von Otto Wesendonck beglichen, einem
Geschäftsmann, der in New York eine profitable Import-Firma besitzt und nun
in Zürich lebt. Seine 24jährige Frau Mathilde bewundert Wagner und wird sehr
von seiner Musik bewegt. Auszüge der Opern Tannhäuser, Rienzi, Lohengrin und Der fliegende Holländer werden in einem Züricher Hotel als Konzerte dargeboten und als »Wunder« gefeiert, aber der Komponist Robert Schumann verurteilt Wagners Schöpfungen als dissonant und formlos. Im Oktober trifft RW Cosima, die Tochter von Franz Liszt, auf einer Reise nach Paris. |
|
1854 |
Richard Wagner glaubt, im Philosophen Arthur Schopenhauer
eine verwandte Seele gefunden zu haben; seine Bewunderung für ihn wird nicht
erwidert. Weiterarbeit an der Musik des Opernzyklus Der Ring des
Nibelungen und erste Ideen zur Oper Tristan und Isolde.
Sein Mäzen Otto Wesendonck zahlt Wagners inzwischen auf 2500 Taler aufgelaufenen Schulden. Wagner versucht mehrfach ohne Erfolg, eine Einreiseerlaubnis für Deutschland zu erhalten. Minna klagt über Herzbeschwerden. Das Rheingold (WWV 86A), die erste Oper des vierteiligen Rings, wird zu Ende des Monats Mai fertig. |
|
1855 |
Auf Konzertreisen nach Paris und London in der Zeit von
Februar bis Juli erntet Richard Wagner mit seinen Interpretationen der Werke
von Mozart, Beethoven und Weber die Ovationen des Publikums, aber die
Kritiker sind weniger grosszügig.
Nach seiner Rückkehr nach Zürich kommt eine längere Zeit mit Erkrankungen und viel Nervosität, die in Wagners Zweifeln an seiner Arbeit gründet. Besuche von Freunden und kurze Reisen sind jeglicher produktiven Tätigkeit hinderlich. |
|
1856 |
Die Walküre (WWV 86B) ist fertig, die zweite Oper der Tetralogie Der Ring des Nibelungen. Viele der wichtigsten Ideen für die dritte Oper, Siegfried, sind schon ausgearbeitet, zum Beispiel die musikalische Charakterisierung der Hauptgestalten durch Motive. |
|
1857 |
Der begabte Pianist und Dirigent Hans von Bülow, Freund und
Bewunderer Richard Wagners, heiratet Cosima, die Tochter von Franz Liszt.
RW komponiert die Musik zu fünf Gedichten von Mathilde Wesendonck und widmet sie ihr; sie werden unter dem Namen Wesendonck-Lieder (WWV 91) bekannt. |
|
1858 |
Dem gärenden Konflikt zwischen Mathilde, die sich als Wagners Muse sieht, und seiner Frau Minna weicht er aus durch eine Reise nach Paris und später, im August, nach Venedig. Er ist mit Feuer und Flamme an der Arbeit zu Tristan und Isolde. | |
1859 |
Italiens Freiheitskrieg beginnt. Die Provinz Venetia mit
ihrer Hauptstadt Venedig bleibt im Besitz der Österreicher. Wagner wird
ausgewiesen und kommt zurück nach Zürich, wo er in einem Haus auf dem
Anwesen der Wesendoncks wohnt, so als ob die Spannungen zu dieser und in
seiner eigenen Familie nie existiert hätten. Tristan und Isolde (WWV
90) stellt er schon im August fertig.
Trotz der grossen Nachfrage nach seinen begnadeten Interpretationen als Dirigent und obwohl selbst seine schwierigsten Opern immer gefragter sind, lebt Richard Wagner weit über die Verhältnisse, die sich ihm damit bieten. Im November reist er für längere Zeit wieder nach Paris und macht dort die Bekanntschaft von Hector Berlioz, Leo Tolstoi, Charles Beaudelaire und Giacchino Rossini, dem offiziellen Hofkomponist und einflussreichen Direktor des Théâtre Italien. Endlich gibt man Wagner eine partielle Amnestie, nach der er jetzt in alle deutschen Staaten ausser Sachsen reisen kann. |
|
1861 |
Das vergangene Jahr brachte Wagner viel Erfolg und
Unterstützung aber leider keine Besserung der finanziellen Situation. Er macht Pläne für eine neue Oper, Die Meistersinger von Nürnberg. Reisen von der Schweiz nach Frankreich, Deutschland und Österreich, stets zu Aufführungen oder Proben seiner Opern. In Paris werden beide Vorstellungen des Tannhäuser von Pfiffen und Zwischenrufen gestört. |
|
1862 |
Die Ouvertüre der Oper Die Meistersinger von Nürnberg
kommt in Leipzig zur Uraufführung und wird freundlich aufgenommen. Der
vollständige Operntext wird im Januar fertig.
Richard (jetzt 49 Jahre alt) und Minna (53 Jahre) trennen sich im November, nach 26 Jahren einer stürmischen Ehe. RW wird eine volle Amnestie gewährt, auch für Sachsen. |
|
1863 |
Wagner dirigiert eine Reihe von Konzerten in Prag,
St.
Petersburg, Moskau, Buda
(=Budapest), Karlsruhe,
Breslau und Wien und erhält überall, wo er auftritt, die
Huldigungen des Publikums. Er gibt sofort alle Einnahmen wieder aus, mietet
eine Villa in Wien und möbliert sie aufs Luxuriöseste, obwohl ihm endgültig
der Ruin droht.
Cosima von Bülow, jetzt 27 Jahre alt und Gemahlin des Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow, und Richard Wagner schwören sich ewige Treue. |
|
1864 |
RWs Lage verbessert sich plötzlich: er trifft den jungen
König Bayerns, Ludwig II (geb. 1845), der sofort alle von Wagners
beträchtlichen Schulden abzahlt und ihm ein Haus in München und eine Villa
ausserhalb der Stadt zur Verfügung stellt.
Im Herbst gibt Luwig II Wagner offiziell den Auftrag, den Ring des Nibelungen fertigzustellen; ausserdem beruft er Gottfried Semper, einen von Wagners Freunden und Architekt der monumentalen Staatsoper in Dresden, und trägt ihm auf, Pläne für ein grosses Festspielhaus in München auszuarbeiten, das den Anforderungen des Komponisten entspreche. |
|
1865 |
Wagners Einfluss als Vertrauter des Königs (der oft auch
»der verrückte König« oder »der Märchenkönig« genannt wird) ist am
Schwinden. Die Tatsache, dass er ein höheres Gehalt bezieht als alle anderen
Minister des Königs, die Vorstellung, dass ein Riesen-Theater
ausschliesslich für seine Werke gebaut werden soll, und eine ganz allgemeine
Unzufriedenheit über des Königs phantastischen Bauvorhaben (z.B.
Neuschwanstein), alle diese Gründe führen zu öffentlichen Unruhen und zu
Intrigen bei Hofe, die in der Forderung nach Wagners Entlassung gipfeln.
Im April wird Cosima von Bülows und Richard Wagners Tochter Isolde geboren. Trotz aller Produktionsschwierigkeiten, Proben ohne Ende, den üblichen Kostenüberschreitungen und Aufschüben der letzten Minute, wird die Uraufführung von Tristan und Isolde (WWV 90) unter der Leitung von Hans v. Bülow im Juli ein grosser Erfolg, selbst in den Augen Wagners. Die Zuhörer bringen ihm jubelnde Huldigungen dar und sogar die Kritiker nennen ihn einen grossen Komponisten. Trotzdem lassen die Feindseligkeiten und Intrigen bei Hof nicht ab. Der Sekretär des Königs überbringt Wagner eine Botschaft, in der Ludwig II ihn bittet, das Land eine Zeitlang zu verlassen. Am 10. Dezember kehrt Wagner in die Schweiz zurück und lässt sich in Genf nieder. |
|
1866 |
Am 25. Januar stirbt Wilhelmine (Minna) Wagner in
Dresden
an einem Herzanfall. Die Nachricht ihres Todes erreicht RW in Marseille, wo er sich gerade nach einer Wohnung umschaut. Er reist nicht
zum Begräbnis, vielleicht weil er einfach nicht will, oder aber weil er
glaubt, sowieso nicht mehr rechtzeitig nach
Dresden zu kommen.
Cosima und Richard finden eine Villa am Ufer des Vierwaldstätter Sees in der Schweiz, in einem Ort namens Tribschen, und in der werden sie die nächsten sechs Jahre wohnen. König Ludwig II von Bayern besucht sie obwohl sein Land, mit Österreich alliiert, gerade im Krieg mit Preussen liegt. Die Niederlage Bayerns im Juli bleibt ohne ernste Folgen für das Land oder den König. Das Dreiecksverhältnis von Cosima, ihrem Ehemann Hans von Bülow und Richard Wagner gibt Anlass zu Reibungen, die allerdings Bülows Bewunderung für Wagner nicht beeinflussen. Die Arbeit an der Oper Die Meistersinger von Nürnberg geht gut voran. |
|
1867 |
Cosimas und Richards zweite Tochter, Eva, kommt im Februar
zur Welt.
Ludwig II ernennt Hans von Bülow zum Kapellmeister in München. Wagner und v. Bülow arbeiten miteinander an der Produktion des Lohengrin (WWV 75). Der König und RW haben Auseinandersetzungen über die Wahl der Schauspieler und Sänger; Wagner ärgert sich so, dass er der Premiere fernbleibt. Die Oper ist ein triumphaler Erfolg. Auf Wunsch des Königs wird Tannhäuser (WWV 70) nochmals aufgeführt und Wagner steigt im Ansehen der Bevölkerung. Die ersten Aufsätze Wagners in einer geplanten Serie mit dem Titel »Deutsche Kunst und deutsche Politik« werden in Die Süddeutsche Presse veröffentlicht, aber eine Fortsetzung wird wegen der Angriffe Wagners auf Ludwig II Vorgänger, nämlich seinen Vater Maximilian II von Bayern, verboten. Die Oper Die Meistersinger von Nürnberg wird am 24. Oktober fertig. |
|
1868 |
Semper legt sein Amt als Architekt des Festspielhauses in
München nieder.
Uraufführung der Meistersinger (WWV 96) in München unter Leitung von Hans von Bülow. Die Aufführung ist ein wahrer Triumph für Wagner. RW lernt den jungen Philosophen Friedrich Nietzsche kennen, der sich enthusiastisch über Wagners Musik äussert. |
|
1869 |
Am 6. Juni wird Cosimas und Wagners Sohn Siegfried geboren,
das dritte Kind des Paares. Hans von Bülow gibt seine Einwilligung zur
Scheidung von Cosima.
Nietzsche, jetzt Professor für klassische Philologie an der Universität Basel wird ein naher Freund und besucht die Wagners häufig in Tribschen. Cosima beginnt ein Tagebuch, das ein wichtiges Zeugnis zur Biographie der späteren Jahre Richard Wagners wird. Ludwig II drängt Wagner, Das Rheingold (WWV 86A) in München auf die Bühne zu bringen. Die Inszenierung der Oper verzögert sich verschiedene Male, hauptsächlich wegen Schwierigkeiten mit der Besetzung der Rollen. Wagner besteht darauf, dass die Oper nur als Teil der (noch nicht fertig gestellten) Tetralogie Der Ring des Nibelungen aufgeführt werden soll; der König ist darüber verärgert und bestellt Franz Wüllner als Dirigenten, einen Mann, den Wagner nicht schätzt. Allerdings hat er die Alleinrechte am ganzen Zyklus im voraus an Ludwig II verkauft und kann daher keinen Einwand erheben. Er kommt nicht zur Premiere seiner Oper am 22. September. |
|
1870 |
Die Oper Die Meistersinger von Nürnberg wird in
Berlin gegeben; das Publikum ist indifferent.
Die Walküre (i.e. die zweite Oper im Ring-Zyklus) wird gegen Wagners ausdrücklichen Wunsch in München in Szene gesetzt. Nach einer Pause von mehr als zehn Jahren beginnt Wagner von neuem, ernsthaft an Siegfried und Die Götterdämmerung zu arbeiten, also an der dritten und vierten Oper des Ring des Nibelungen. Das Rheingold und Die Walküre werden abwechselnd in München aufgeführt und mit grossem Beifall bedacht. Franz Liszt, der Geigenvirtuose Joseph Joachim und der Komponist Johannes Brahms (den Wagner verachtet) hören beide Opern. Etwa einen Monat nach ihrer Scheidung von Hans v. Bülow heiratet Cosima (geb. Liszt) Richard Wagner in einer protestantischen Zeremonie in Luzern. |
|
1871 |
Wagner schreibt den pompösen Kaisermarsch (WWV 104)
und widmet ihn Wilhelm I, dem Preussenkönig, der nach der Niederlage der
Franzosen in Versailles zum deutschen Kaiser gekrönt wird.
Am 5. Februar wird die Oper Siegfried (WWV 86C) fertig. RW glaubt, in der kleinen Stadt Bayreuth in Bayern den idealen Ort für das seinen Werken gewidmete Opernhaus gefunden zu haben. Er stellt es sich als das künftige nationale Musikzentrum vor, natürlich unter seiner Leitung, und er unterbreitet Ludwig II diesen Vorschlag. Im Mai reist er nach Berlin, um vom Kaiser finanzielle Hilfe für das Projekt zu bekommen, aber schliesslich erhält er von privaten Quellen nur einen Bruchteil der Summe, die er sich erhofft hat. Etwas übereilt kündigt er an, dass die Ersten Bayreuther Festspiele im Sommer 1873 stattfinden werden. Friedrich Nietzsche überrascht die Familie Wagner mit einer seiner eigenen Kompositionen und ist aufs tiefste verletzt, als Hans von Bülow seinen musikalischen Ehrgeiz mit Worten zerstört wie, u.a., »das Extremste von phantastischer Extravaganz ... das Unerquicklichste und Antimusikalischste ... bedauerliche Klavierkrämpfe«. |
|
1872 |
Im Januar gibt der Rat der Stadt Bayreuth Wagner die
Erlaubnis, ein Festspielhaus auf einem Grundstück zu errichten, das die
Stadt erworben hat; RW kauft ein Stück Land in der Nähe, auf welchem seine
Villa Wahnfried gebaut werden soll.
Der Grundstein für das neue Festspielhaus wird im Mai gelegt, in strömendem Regen. Eine grosse Feier im alten Theater folgt (im prunkvollen Markgräflichen Opernhaus), mit einer Aufführung von Beethovens Neunter Symphonie. Aus ganz Deutschland kommen Abgesandte der vielen Wagner-Vereine, die einen Beitrag zur Finanzierung des Hauses als ihre vaterländische Pflicht ansehen. Wagner schöpft neuen Mut und hofft, das Opernhaus ohne Geld von Ludwig II bauen zu können. In den Monaten November und Dezember reisen Cosima und Richard durch Deutschland, um Geld für den Bau des Festspielhauses zu sammeln und Musiker anzuwerben. Sie sehen einige Opern und über diese Vorstellungen schreibt Wagner nach ihrer Rückkehr einen vernichtenden Bericht. Richard Wagner zeigt die ersten offensichtlichen Symptome einer Herzerkrankung. |
|
1873 |
Die Finanzierung des Festspielhauses wird immer
schwieriger, hauptsächlich deshalb, weil Deutschland wie fast alle
europäischen Länder in einer Wirtschaftskrise steckt. Wagner richtet ein
Gesuch an Bismarck, den Kanzler des Deutschen Reiches, aber er erhält keine
Antwort. Auch an Ludwig II wendet er sich mit der Bitte um einen Kredit für
die Ersten Bayreuther Festspiele, die er jetzt auf 1875 verschoben hat.
RW ist ständig auf Konzertreisen durch die deutschen Staaten, auf der Suche nach Gönnern für den Bau des Opernhauses. Das Richtfest wird im August gefeiert aber der letzte Bauabschnitt ist noch nicht finanziell gesichert. Der bayerische König hat sich bislang gesträubt, die nötigen 100 000 Taler vorzustrecken (immerhin ein Drittel der Gesamtbaukosten) oder auch nur einen Kredit zu garantieren. Die Einkünfte von mehr als 200 Vorstellungen von Wagners Opern in diesem Jahr allein sind bei weitem nicht genug. Der Verkauf von 1300 sogenannten Patronats-Scheinen (eine Art von Aktie ohne Zahlung von Dividende) geht nur langsam voran, obwohl Wagner selbst versucht, sie am Ende seiner Konzerte an den Mann zu bringen. Trotz all diesen Geldschwierigkeiten wird Wagner überall, wo er sich zeigt, von einer jubelnden Menge begrüsst, man gibt Bankette und Zeremonien aller Art ihm zu Ehren. Die Zahl der getreuen Wagner-Anhänger wächst stetig, aber die Patronatsscheine gehen nur sehr langsam weg. Nur 200 sind bis zu dieser Zeit verkauft worden, davon ein grosse Zahl allein an den Khediven von Ägypten. Der zweite Band von Wagners Autobiographie Mein Leben, von Cosima nach Diktat aufgenommen, wird in Basel veröffentlicht. |
|
1874 |
Endlich bewilligt Ludwig II den lange ersuchten Kredit von
100 000 Talern.
Die Familie Wagner bezieht ihr neuerbautes Haus, die Villa Wahnfried. Die Eingangshalle und der grosse Saal im Erdgeschoss dienen bald der Präsentation neuer Werke, hier werden alle möglichen musikalischen und Theater-Vorstellungen gegeben, Proben finden hier statt und lebhafte Diskussionen in einem Kreis von Freunden und Gästen. Am 21.November schreibt Wagner die letzten Takte der Oper Götterdämmerung (WWV 86D), der vierten im Zyklus Der Ring des Nibelungen, an dem er mit Unterbrechungen 21 Jahre lang gearbeitet hat. Die Eröffnung des Festspielhauses wird nochmals verschoben, auf das Jahr 1876. |
|
1875 |
Richard Wagner ist fast das ganze Jahr lang unterwegs auf Konzertreisen durch Deutschland und Österreich. In Bayreuth beginnen die Proben für den Ring. | |
1876 |
Wagner komponiert den Grossen Festmarsch (WWV 110)
zur Hundertjahrfeier der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten
von Amerika. Er erhält das fürstliche Honorar von $ 5000.
Die vier Teile des Ring des Nibelungen werden am 13., 14., 16. und 17. August zur Einweihung des Bayreuther Festspielhauses aufgeführt, vor dem deutschen Kaiser, König Ludwg II, Kaiser Dom Pedro von Brasilien, einer Reihe von Persönlichkeiten des Adels und vor berühmten Künstlern wie Peter Tschaikowski, Anton Bruckner, Franz Liszt und Camille Saint-Saëns. Fast jede Szene wird unterbrochen von Applaus, der sich zur Ovation steigert. Jede Vorstellung ist ein Triumph für Richard Wagner. Es stellt sich heraus, dass das Opernhaus eine fabelhafte Akustik hat. Die Musiker sind noch nicht gewohnt, im Orchestergraben zu sitzen, wo das Publikum sie nicht sehen kann, aber Besucher mit einem Ohr für Musik sind sich einig, dass der Ton nicht weniger als wundervoll ist. Die zweite und dritte Vorstellung des gesamten Ring-Zyklus beginnen am 20. und am 27. August. Das Haus ist jedes Mal bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die einzige Person unzufrieden mit den Aufführungen ist Richard Wagner selbst, natürlich ausser den Kritikern, die, wie üblich, kaum ein gutes Wort für seine Werke haben. Er ist nahezu vezweifelt, als ihm mitgeteilt wird, dass die Festpiele das riesiges Defizit von 148 000 Mark erwirtschaftet haben. Er sucht Trost in den Armen von Judith Gauthier, einer jüngst geschiedenen Frau, bis Cosima von der Romanze erfährt und ihr ein Ende setzt. Eine drei Monate dauernde Reise der Wagners nach Italien wird von der neuerlichen Geldkrise überschattet. |
|
1877 |
RW nimmt die Arbeit am Entwurf der Oper Parsifal
wieder auf, an einer Geschichte, über die er seit spätestens 1865
nachgedacht hat. Das ganze Libretto der Oper ist schon im April fertig.
Ein Impresario aus London verspricht Wagner, eine Serie von 20 Konzerten unter seiner Leitung in der Royal Albert Hall zu arrangieren; die Einkünfte würden mit einem Schlag alle Schulden des Meisters tilgen. Der Plan erweist sich als viel zu optimistisch. Acht Konzerte mit Auszügen der Walküre und des fliegenden Holländers werden im Monat Mai in der Tat gegeben, aber sie bringen Wagner nur etwa 700 Pfund Sterling ein, d.h. nur etwa ein Zehntel des Bayreuther Defizits. Wagner glaubt fest, dass seine Kunst, voll von deutschem Patriotismus und Ausdruck der deutschen Seele, vom Publikum falsch verstanden wird, von der Presse ins Lächerliche gezogen wird und daher bei Finanzleuten nicht ankommt. Er erwägt, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Die Poesie des Textes zur Oper Parsifal und die ersten musikalischen Entwürfe begeistern Friedrich Nietzsche. |
|
1878 |
Wagner arbeitet an der Partitur des Parsifal, nach
eigenen Worten seine grösste Leistung.
Cosima ist im März damit beschäftigt, mit der Regierung von Ludwig II einen Vertrag auszuhandeln, wonach ausschliesslich das Königliche Theaterhaus in München den Parsifal aufführen darf, und zwar ohne Zahlung von Tantiemen an den Komponisten, gegen die Garantie, das Defizit der Festspiele zu decken. Wagner soll jedoch 10 Prozent der Einkünfte seiner anderen Opern erhalten. RW publiziert einige Aufsätze über Kunst und Kultur in den Bayreuther Blättern, für die sein Freund, der Musikkritiker Richard Pohl, arbeitet. In diesem Jahr, an das man sich wegen der offiziellen Unterdrückung der sozialdemokratischen Bewegung erinnert, verhehlt Wagner nicht, dass er an die Rettung Deutschlands durch den Sozialismus glaubt. |
|
1879 |
Richard Wagners Gesundheitszustand ist schlecht. Er leidet an einem schon wiederholt aufgetretenen Ekzem, hat Bauchschmerzen, Rheumatismus und klagt über Schwäche. Trotz allem ist die Arbeit an Parsifal fast vollendet. | |
1880 |
Richard und Cosima verbringen die ersten neun Monate des
Jahres auf einer Reise durch Italien. Der vierte Band seiner Autobiographie
(bis zum Jahre 1864) wird veröffentlicht.
Im November dirigiert Wagner das Parsifal-Vorspiel in München, in einer privaten Vorstellung für den König. Er ist verärgert, als der König auch die Ouvertüre zu Lohengrin hören will. An diesem Tag sehen sich Wagner und der König zum letzten Mal. |
|
1881 |
Als einige deutsche Fürsten übereinkommen, die Bayreuther
Festspiele zu fördern, beeilt sich Ludwig II ein Beispiel seiner Gunst und
Grosszügigkeit zu geben und verzichtet auf das exklusive Recht, die Oper
Parsifal in seinem Theater in München aufzuführen.
Wagner verfasst eine Reihe von Aufsätzen über Religion, die Künste, Gleichberechtigung für alle, Heroismus usw. Die Arbeit am letzten Akt des Parsifal wird gestört durch erneute Verdauungsprobleme und Atembeschwerden. Im November fliehen Cosima, Daniel, Siegfried und Richard Wagner das schlechte Wetter in Bayreuth und reisen nach Palermo auf Sizilien. |
|
1882 |
Die Oper Parsifal (WWV 111) wird am 13. Januar in
Palermo fertig. Richards Gesundheit hat sich etwas gebessert, aber er leidet
unter seiner Herzkrankheit. Die Familie kehrt im Mai nach Bayreuth zurück.
Die Zweiten Bayreuther Festspiele werden am 26. Juli mit der Premiere von Parsifal eröffnet. Eduard Hanslick aus Wien, der Wagners Werke bisher mit beissender und schroffer Kritik bedacht hat, ist von der Musik bezaubert. Das Publikum klatscht volle vierzig Minuten. Die Oper wird bis zum 29. August, dem Ende der Festspiele, noch fünfzehn Mal gegeben. Die Wagners ziehen im September nach Venedig. Im Dezember steigt RW zum letzten Mal aufs Podium, um seine Symphonie in C-dur (WWV 29) zu dirigieren. |
|
1883 |
Die Familie mietet eine Etage im Palazzo Vendramin in
Venedig, direkt am Canale Grande. Das schlechte Winterwetter kann die
Fröhlichkeit des Karneval-Umtriebs in den Strassen nicht mindern, und RW
lässt sich mitten hinein ziehen.
Ein massiver Herzanfall beendet sein Leben am Nachmittag des 13. Februar, drei Monate vor seinem siebzigsten Geburtstag. Er wird im Garten seiner Villa Wahnfried in Bayreuth beerdigt. |
|
Literaturempfehlungen |
||
|
Hans-joachim bauer: Richard Wagner. Verlag Ullstein, Frankfurt/M: 1995 Udo bermbach: Richard Wagner. Ellert & Richter Verlag, Hamburg: 2006 John deathridge, Martin Geck, Egon Voss: Wagner-Werkverzeichnis. Schott, Mainz: 1985 Philippe Godefroid: Richard Wagner, l’opéra de la fin du monde. Gallimard, Paris: 1988 Martin Gregor-Dellin: Wagner-Chronik. Carl Hanser Verlag, München: 1972 Hans Mayer: Wagner. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg: 1959 Stewart Spencer: Wagner Remembered. Faber & Faber, London: 2000 |
||